Haftung des Geschäftsführers bei fraglicher Beseitigung der Insolvenzreife
Haftung des Geschäftsführers auch in Zukunft gegenüber einem Neugläubiger auf Grund einer ursprünglich eingetretenen Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung), wenn sich die Gesellschaft erholt?
Der Fall
Der BGH hat in seiner Entscheidung vom 19.11.2019 – II ZR 53/18 über den Fall eines Neugläubigerschadens im Rahmen einer Insolvenz zu entscheiden. Dabei stellte sich die Frage, inwieweit ein Geschäftsführer einer Gesellschaft für den Schaden eines Vertragspartners haftet, wenn zwar die Gesellschaft in der Vergangenheit insolvent war, aber im Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit dem Gläubiger ein Insolvenzgrund auf Grund der Erholung der Gesellschaft nicht mehr vorlag.
Entscheidung des BGH zur Haftung des Geschäftsführers
Die Entscheidung des BGH verlangt eindeutig, dass es auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses ankommt. Da es sich bei einer Insolvenzverschleppung um ein Dauerdelikt handelt, müssen deren objektive und subjektive Voraussetzungen zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses noch vorliegen.
Ergebnis
Der klagende Neugläubiger musste daher beweisen, dass ein Insolvenzgrund noch im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorlag. Er konnte nicht pauschal darauf verweisen, dass die Insolvenz bereits in der Vergangenheit einmal eingetreten war. In seiner Entscheidung zeigt der BGH jedoch auf, wie dem Neugläubiger dieser Nachweis möglich ist. So gilt nach der Rechtsprechung der Nachweis im Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses bei relativ zeitnah erteilten Aufträgen als geführt. Ein zeitlicher Zusammenhang von 9 Monaten bis zu einem Jahr reicht hierfür aus. In diesem Fall muss der Geschäftsführer darlegen und beweisen, dass im Zeitpunkt der Auftragserteilung z. B. eine Überschuldung nachhaltig beseitigt und damit die Antragspflicht entfallen war.
Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Internetseite Haftung des Geschäftsführers und Insolvenzverschleppung.
Frage 1
Antwort 1
Frage 2
Antwort 2

 @RADirkTholl
@RADirkTholl
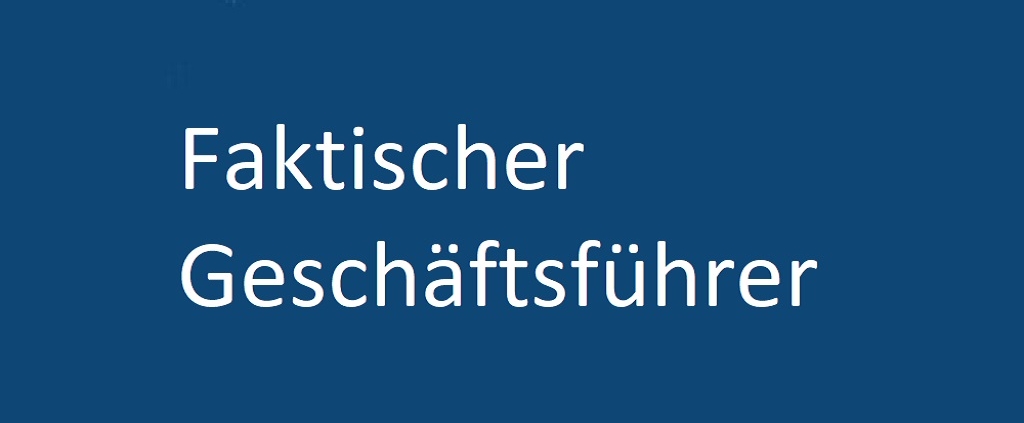 @Tholl
@Tholl